Ich kann nur sagen, ob's mir schmeckt...

Oft höre ich diesen Satz:
"Ich verstehe nichts von Kaffee. Ich kann nur sagen, ob mir etwas schmeckt oder nicht."
Es ist die absolute Defensive, auf die sich manche verlegen, wenn sie in den zweifelhaften Genuss kommen, mit mir über Kaffee zu sprechen – oder mit Fachleuten, die zum Beispiel erlesene Weine, Single-Malt-Whiskeys oder erstklassige Manufakturbiere erklären. Es ist ein Gemeinplatz: De gustibus non est disputandum. Doch wenn man über Geschmack nicht streiten kann – wozu ist er überhaupt gut?
Die Organe, mit denen wir riechen und schmecken, verfügen über eine bestimmte Anzahl an Rezeptoren, über die wir die diversen Aromen aufnehmen. Diese Anzahl an Geschmacksknospen variiert von Mensch zu Mensch (so habe ich es bei Tim Wendelboe gelesen); also darf man annehmen, dass die Möglichkeiten, die Komplexität in einer Tasse wahrzunehmen, angeboren sind.
Ohne das auf anatomischer Ebene widerlegen zu können, behaupte ich: Für jede und jeden besteht die Möglichkeit, das Spektrum der wahrgenommenen Geschmäcker feiner abzustufen. Wie kommt man von "Mh, schmeckt nach Kaffee..." zu "Ah ja, Säure roter Beeren, marmeladig-süß, grüner Paprika, im Nachhall Schwarztee."?
Mehr zu schmecken ist einfacher, als man denkt.
Dass solche Geschmacksnotizen geradezu poetisch erscheinen, ist vielleicht kein Zufall. Ich habe immer wieder Leute erlebt, die sich nichts auf ihre sensorischen Fähigkeiten einbilden, dafür aber literarisch tätig sind, und die sich dabei ganz ungezwungen über ihre Wahrnehmung austauschen. Sie sind dabei produktiv, eben weil sie es gewohnt sind, in den Untiefen ihres Erfahrungsschatzes nach passenden Worten zu angeln. Es ist also buchstäblich zu verstehen: Es ist einfacher, mehr zu schmecken, als man denkt. Denn es wird mehr, schlicht, indem man Worte findet und nicht zu sehr darüber nachdenkt, ob das, was man assoziiert, „stimmt“.
Mittlerweile habe ich für diese Annahme, die ich schon lange mit mir herumtrage, Evidenz gefunden: Ted Gioia, ein Jazzhistoriker, berichtete auf seinem Substack, dass er als College-Student einen Weinverkostungswettbewerb gewonnen hat – nicht, weil er sich so gut mit Wein auskannte, sondern weil er auf hilfreiche, geradezu poetische Notizen zurückgreifen konnte. Hier meine Übersetzung:
Ich hatte noch nicht einmal das gesetzliche Mindestalter für den Konsum von Alkohol erreicht und wusste so gut wie nichts über Wein – aber das war nur ein kleiner Teil des Problems. Noch schlimmer war, dass die anderen Teilnehmer diese Weine bereits in der Woche zuvor verkostet hatten, ich jedoch nicht dabei war. Und nun mussten wir alle dieselben Jahrgänge in einer Blindverkostung identifizieren. Ich hatte also keine Chance, den Wettbewerb zu gewinnen – ich würde lediglich raten. Doch in letzter Minute gab mir einer der anderen Teilnehmer seine Verkostungsnotizen aus der vorherigen Sitzung. Er hatte seine subjektiven Eindrücke zu jedem Wein niedergeschrieben. „Vielleicht kannst du die Weine anhand meiner Beschreibungen identifizieren“, schlug er vor.
Ich lachte über diesen Vorschlag. Aber dann sah ich mir seine Notizen an, die sehr detailliert und poetisch waren. Sie lauteten in etwa so:
„Dieser stürmische Weißwein riecht wie der Hinterraum einer örtlichen Reinigung. Ich hoffe immer noch auf einen Hauch von Süße, aber jemand muss diesen Wein auf Kleiderbügeln mit extra Stärke bestellt haben.“
Oder:
„Dieser ledrige Rotwein ist gerade durch einen Blumengarten gelaufen. Aber man riecht nur kurz Tulpen und Narzissen und mehr Schuhschweiß als beides. Der Nachgeschmack verschwindet schneller als ein Taschendieb auf Rollschuhen. Trink diesen Jahrgang also schnell – und nicht vergessen, sich vorher die Nase zuzuhalten.“
Man kann sich vorstellen, dass wir damals nicht die besten Weine getrunken haben. Aber diese Notizen gaben mir etwas, womit ich arbeiten konnte, als ich versuchte, die Jahrgänge zu identifizieren.
Und können Sie sich vorstellen, was passiert ist? Ich habe diesen Wettbewerb gewonnen.
Er folgert daraus – und das belasse ich auf Englisch:
The discipline of taking notes can evolve into taking notice—which is a much higher level activity.
Tatsächlich also empfehle ich jedem, sich auf den Geschmack seines Morgenkaffees einzulassen und ihn ernst zu nehmen. Anstatt sich über eine ach so noble Angelegenheit zu unterhalten, um die eigene Belesenheit zu demonstrieren, spreche man fröhlich über das eigene Erleben. Lassen wir das Distinktionsmittel beiseite und spielen wir das Sprachspiel auf dem nächsten Level!
Das Sprachspiel der Verkostung
Einmal in Worte gefasst, konkretisiert sich das vage olfaktorische Erleben zunehmend. Gegenständlich, wie ein Tennisball, springt es nun zwischen Gesprächsteilnehmern hin und her:
– „So, Zitrusfrüchte, oder?“
– „Mh, Bergamotte? Sehr typisch für äthiopischen Yrgacheffe.“
– „Ah, genau das! Daher auch dieser Eindruck von Tee.“
So sind auch die mittlerweile oft auf Verpackungen aufgedruckten Geschmacksnotizen mit Vorsicht zu genießen. Sie entstehen genau so – in Gesprächen am Tisch beim Cupping. Diese Beschreibungen dienen vor allem dazu, eine Bohne von gleichzeitig blindverkosteten Proben zu unterscheiden. Profis treffen an dieser Stelle weitreichende Entscheidungen: Welche Punktezahl verdient dieser Kaffee? Welchen Preis können wir dafür verlangen? Sollen wir die nächste Ernte wieder so aufbereiten? Welchen Rohkaffee bestellen wir säckeweise? Wie viel brauchen wir für unsere Standard-Blend? Was können wir unseren Kund*innen mit Überzeugung verkaufen?
Und natürlich ist es auch ein Spiel zwischen den Teilnehmern des Cuppings: Manche wollen sich als sensorisch begabt profilieren, andere versuchen, gemeinsam mit ihren Kolleg*innen einen bestimmten Stil zu finden; wieder andere wollen eine Hypothese falsifizieren oder eine getroffene Entscheidung rechtfertigen.

Jene, die Verpackungen gestalten, wollen vor allem eins: Kaffee verkaufen. Was ich als erdige, würzige Geschmackstöne bezeichne, hört sich gleich viel zugänglicher an, wenn man „schokoladig-nussig“ sagt. Wer aber schon einmal Rohkakao probiert hat, weiß, dass auch dieser ein immenses Geschmacksspektrum aufweisen kann – lebendig-fruchtig, erdig oder bitter. Unsere Vorstellung von Schokolade ist stark geprägt durch Schweizer Chocolatiers, die große Mengen Kuhmilch und Rohrzucker hinzufügen.
Antrainerbare Stilsicherheit
Das Erschmecken dessen, was einem schmeckt, führt letztlich dazu, unausgesprochene Erwartungen zu hinterfragen. Wenn ich einmal ausgelassener über meine geschmacklichen Impressionen bei einem Kaffee plauderte, wurde mir des Öfteren entgegnet:
„Will ich wirklich, dass mein Kaffee nach ‚gekochtem Rhabarber‘ schmeckt?“
Die kurze Antwort: Ja, wenn auch nicht jedes Mal.
Wer seine Erwartungen an internalisierte Gewohnheiten einmal beiseitelegen kann und sich statt eines dampfend heißen Milchgetränks auf die kristallklare Struktur eines dunkel-orangenen, lauwarmen Filterkaffees einlässt, der kann geschmackliche Überraschungen nicht nur wahrnehmen, sondern wahrscheinlich auch lieben lernen. Denn damit einher geht die Erkenntnis, dass der Kaffee, an den man sich notgedrungen gewöhnt hat, oft gar nicht so gut ist. Dieses leichtere Getränk ist wahrscheinlich süß – aber nicht, weil es an Italienurlaub erinnert, sondern weil seine Süße von Säuren getragen wird, die auf der Zunge ein prickelndes, sonniges Geschmackserlebnis hervorrufen.
Die gute Nachricht: Es steht jedem frei, sich auf diese Assoziationen einzulassen. Kaffee muss keine uniforme Begleiterscheinung sein, die einen auf die Zumutungen des Arbeitstages vorbereitet. Ein kurzes Innehalten vor dem Herunterschlucken reicht völlig aus, um Notiz vom Geschmack zu nehmen. Sich Zeit zu nehmen, das richtige Wort zu finden, heißt, etwas Wertvolles zu entdecken und Kontakt zu den nicht ständig genutzten Geisteskapazitäten aufzunehmen. Übertrieben kritisch zu sein, ist nicht nötig – es reicht zu fragen: Woran erinnert es?
Wenn nicht sofort Kopfkinos anspringen, kann man zumindest den Prozess des einzelnen Schlucks aufteilen. Das lässt sich an einer Hand abzählen – eine gute Faustregel der Verkostung:
- Aroma: Was rieche ich, wenn ich die Nase in die Tasse stecke?
- Geschmack: Welche Aromen entfalten sich am Gaumen? (Intensität von Süße, Säure, Bitterkeit)
- Balance: Wie harmonieren diese miteinander?
- Mundgefühl/Körper: Wie fühlen sie sich auf der Zunge an?
- Nachgeschmack: Was bleibt nach dem Schluck?
Der missachtete Sinn
COVID ließ bekanntlich so manchen den Geschmacksinn verlieren. Und jene, die es selbst erlebten, schilderten dies bisweilen als drastische Einschränkung im Alltag. Das überrascht, wo doch dieser Verlust im Vergleich zu Gesichts- oder Gehörsinn harmlos anmutet. Doch dies zeugt lediglich von der allgemeinen Missachtung von Geruchs- und Geschmackssinn.
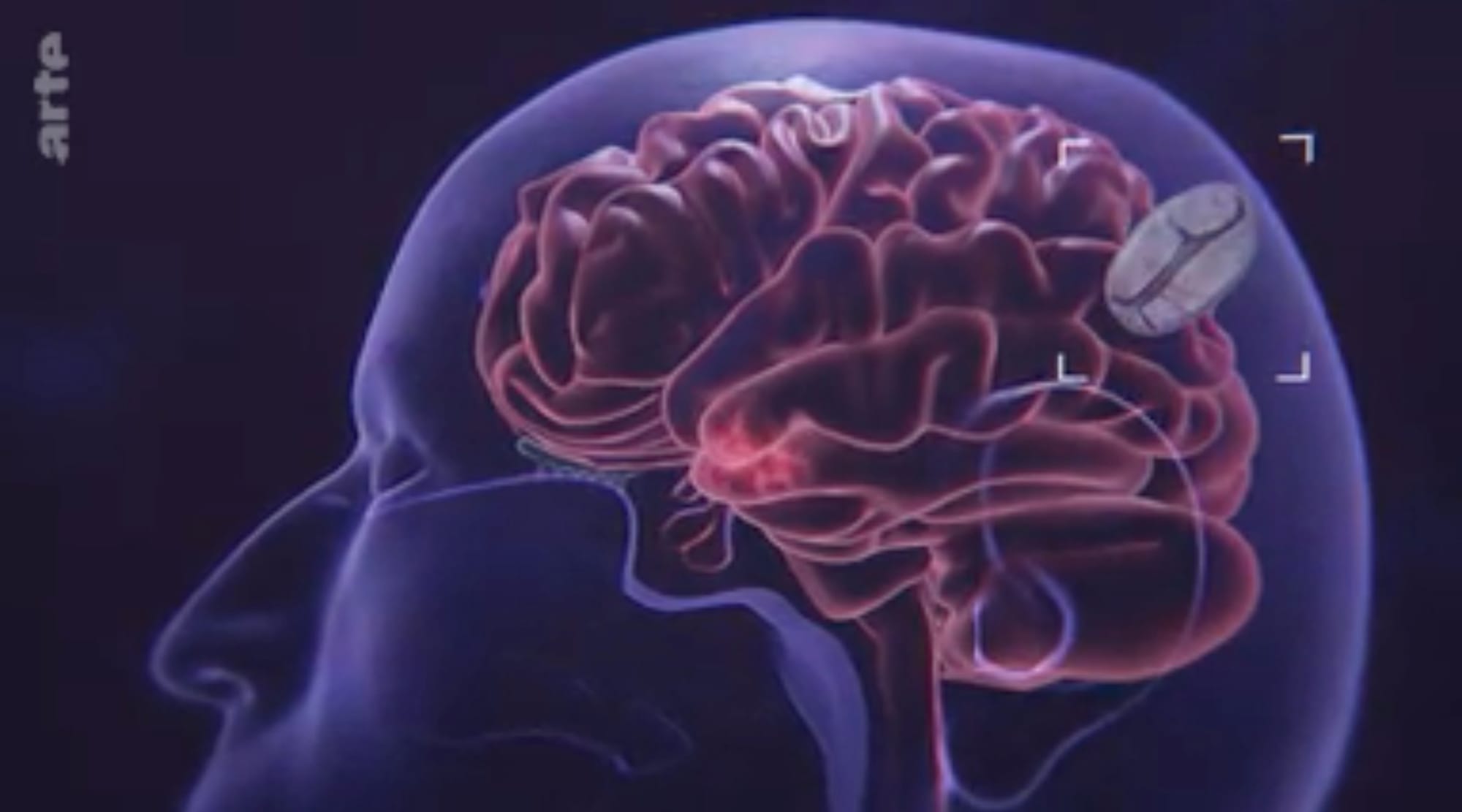
Er meinte damit die Privilegierung des Auges durch bestimmte Eigenschaften wie Distanznahme und Simultaneität: Man kann Dinge nebeneinanderstellen und direkt vergleichen. Hören können wir nur in der vorgegebenen Reihenfolge. Das führt auch dazu, dass wir das Sehen selbst sehen können, nicht aber das Hören hören oder das Schmecken schmecken. Ein flüchtiger Blick in den Wortschatz macht diese Bevorzugung in Bezug auf intellektuelle Vermögen einsichtig: Lichter gehen uns auf, Sachverhalte klären sich, wir sehen ein oder gewinnen Einblicke – Entdeckungen vermitteln sich häufig visuell, sobald der behindernde Schleier gelüftet ist. Schauen heißt also auch, sich souverän zu geben.
Gehör, obwohl in gewisser Abhängigkeit stehend, schützt dennoch nicht vor Missverständnissen. Heute erwarten wir oft mehr als Respekt – so scheint mir – nämlich Empathie und Verständnis. Einfühlungsvermögen entwickelt sich beim Lauschen: man setzt auf Resonanz. Soziale Bande werden häufig mit musikalischen Metaphern beschrieben: Harmonie, Einklang, Takt. Gehörlosigkeit ist kulturgeschichtlich mit Dummheit belastet; die Gebärdensprache war notwendig, um von aufgeklärten Gesellschaften Menschen mit Behinderung Sprachfähigkeit und damit Bildsamkeit zuzuerkennen. Blinde wie Theresias – oder auch der gemeine Brillenträger – können manchmal sogar besser sehen als jene mit makellosem Augenlicht, die hingegen unter Betriebsblindheit leiden.
Der Geruchsinn ist hingegen animalisch, instinktiv. Beschnuppern erzeugt unmittelbare Eindrücke. Oft „kann man sich nicht riechen“, selbst bei moderatem Gestank. Im Vergleich zum Tastsinn haben wir über das Riechen nur eingeschränkte Kontrolle: Es schlägt aus, sobald uns etwas in die Nase dringt. Gerüche können Magenreflexe auslösen oder das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Unabhängig von unserer Sozialität lösen sie biologische Reflexe aus. Unsere vertrauten Hunde sehen schwarz-weiß, hören aber sehr gut – umso besser auf ihre Frauchen* – und wir machen von ihren natürlichen Riechfähigkeiten forensischen Gebrauch. In weniger schmeichelhaften Experimentieranordnungen zeigt sich jedoch, dass auch Menschen gar nicht so schlecht olfaktorischen Spuren folgen können.

Vor allem versetzen uns Gerüche in frühere, erlebte Situationen wie kein anderer Sinn. Nicht nur bei Proust wird die Suche nach der verlorenen Zeit durch den Geschmack der in Lindenblütentee getauchten Madleines ausgelöst; offenbar bestehen räumliche Nähe und Vernetzungen von Gehirnregionen, die Assoziationen wecken und Erinnerungen aktivieren.
Was hat der Alltag also Besseres zu bieten als eine allmorgendliche – und doch höchst komplexe – Tasse Kaffee, um diesen vernachlässigten Sinn zu kultivieren?
Member discussion